Ihr Kind ist beim Lernen sehr frustriert?
Ihr Kind hat gravierende Schwierigkeiten Lesen und Schreiben zu lernen oder beim Rechnen?
Die schulische Förderung reicht nicht aus?
Lerntherapie kann helfen!
In der Lerntherapie werden dem Kind die Lerninhalte durch besondere Methoden so vermittelt, dass ihr Kind mit Freude am Lernen den Lernstoff verinnerlichen kann. Der Teufelskreis aus Misserfolgen und Frustration soll so wieder durchbrochen werden.
Nehmen Sie Kontakt zu mir auf! Ich berate Sie gerne zu den Inhalten einer Lerntherapie und einer eventuellen Kostenübernahme.
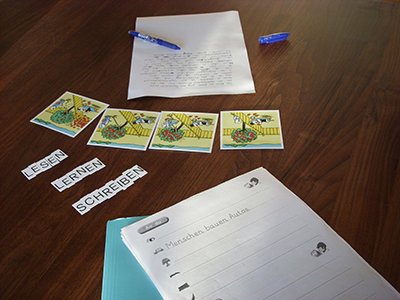
Was ist eine Lese-Rechtschreibstörung?
Manche Kinder haben trotz normaler Intelligenz große Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben – sie lernen langsamer als ihre Klassenkameraden oder machen ungewöhnlich viele Fehler. Früher sprach man oft von „Legasthenie“, ein Begriff, der heute als veraltet gilt und leider mit vielen Vorurteilen behaftet ist.
Stattdessen wird heute meist der neutralere und fachlich präzisere Begriff Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) verwendet. Auch „Lese-Rechtschreib-Schwierigkeit“ oder der englische Begriff „Dyslexie“ sind gebräuchlich.
Wichtig ist: Eine LRS hat nichts mit Faulheit oder mangelnder Intelligenz zu tun. Betroffene Kinder brauchen gezielte Unterstützung – je früher, desto besser.
Was sind die Ursachen einer Lese-Rechtschreib-Störung?
Die Ursachen einer Lese-Rechtschreib-Störung (LRS) sind multifaktoriell – das bedeutet, dass unterschiedliche Gründe zusammenwirken können und zu den Schwierigkeiten beim Erlernen des Lesens und Schreibens führen. Die genauen Ursachen sind bislang nicht vollständig geklärt, doch wissenschaftliche Studien zeigen, dass vor allem genetische Veranlagung und sprachliche Entwicklungsverzögerungen im frühen Kindesalter eine wichtige Rolle spielen.
Kinder, die spät zu sprechen beginnen oder eine Sprachentwicklungsstörung aufweisen (z. B. eingeschränkter Wortschatz, grammatikalische Schwierigkeiten oder Aussprachestörungen), haben ein deutlich erhöhtes Risiko, später eine LRS zu entwickeln.
Auch Aufmerksamkeits- und Konzentrationsprobleme – etwa im Rahmen einer AD(H)S – können das Risiko zusätzlich erhöhen.
Häufig lässt sich eine familiäre Häufung beobachten: Genetische Faktoren beeinflussen unter anderem das Arbeitsgedächtnis oder die Fähigkeit, Wörter schnell und korrekt abzurufen. Diese grundlegenden kognitiven Fähigkeiten sind entscheidend für den erfolgreichen Erwerb von Lesen und Schreiben.
Neben diesen individuellen Voraussetzungen können auch schulische Bedingungen eine Rolle spielen – zum Beispiel die Qualität des Lese- und Schreibunterrichts, die Unterrichtsgestaltung oder das frühzeitige Erkennen und Fördern von Schwierigkeiten.
Können Kinder Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten wieder überwinden?
Ja – aber der Verlauf ist sehr unterschiedlich. Studien zeigen, dass etwa 30–60 % der Kinder, die in der 1. Klasse Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben haben, diese bis zum Ende der Klasse überwinden.
Bleiben die Probleme jedoch bis in die 2. Klasse bestehen, sinken die Chancen auf eine selbstständige Bewältigung deutlich. Ohne gezielte Unterstützung haben viele dieser Kinder auch in höheren Klassenstufen noch große Schwierigkeiten.
Je früher eine gezielte Lerntherapie beginnt, desto besser sind die Erfolgsaussichten. Entscheidend sind außerdem die Unterstützung durch Elternhaus und Schule.
Ab wann ist eine Diagnose möglich?
Bereits im Vorschulalter lassen sich sogenannte Vorläuferfähigkeiten des Lesens und Schreibens erfassen – insbesondere die phonologische Bewusstheit, also etwa das Erkennen von Lauten in Wörtern. Eine frühzeitige Förderung in diesem Bereich kann das Risiko einer späteren Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS) deutlich verringern.
Erste Anzeichen für eine LRS zeigen sich häufig schon ab der Mitte der 1. Klasse. Typische Hinweise sind unter anderem Schwierigkeiten beim Erkennen und Zusammenschleifen von Buchstaben oder beim Verknüpfen von Buchstaben mit den entsprechenden Lauten.
Ab Ende der 1. Klasse bzw. Anfang der 2. Klasse, wenn alle Buchstaben eingeführt sind, ist eine zuverlässige Testung in der Regel problemlos möglich.
Was können Eltern tun?
Unterstützen Sie Ihr Kind aktiv – aber geduldig:
Bei den Hausaufgaben:
- Geben Sie keine fertigen Lösungen vor. Lassen Sie Ihrem Kind Zeit, selbst zu einer Antwort zu finden.
- Bieten Sie bei Bedarf schrittweise Hilfestellungen an. Statt die komplette Lösung vorzugeben, können Sie z. B. eine Auswahl anbieten, aus der Ihr Kind wählen kann.
- Loben Sie auch kleine Fortschritte – selbst wenn noch Fehler passieren. Erkennen Sie Teilerfolge an, z. B. eine gute Konzentration oder dass Ihr Kind bereits auf Groß- und Kleinschreibung geachtet hat.
- Beziehen Sie Ihr Kind in die Fehlerkorrektur mit ein, anstatt nur auf Fehler hinzuweisen. So lernt es, Verantwortung für den eigenen Lernprozess zu übernehmen.
Für Motivation und Selbstvertrauen:
- Wiederholte Misserfolge können das Selbstbewusstsein stark beeinträchtigen. Loben Sie Ihr Kind gezielt – auch für Stärken außerhalb der Schule.
- Machen Sie keinen Druck, sondern wecken Sie die Neugier aufs Lernen.
- Lesen Sie gemeinsam – z. B. abwechselnd einzelne Abschnitte.
Außerdem hilfreich:
- Bieten Sie spannende Bücher an und besuchen Sie gemeinsam die Bücherei.
- Greifen Sie Themen auf, die Ihr Kind interessieren – so entsteht Lesefreude fast von selbst.
Wie läuft eine Lerntherapie ab?
Am Anfang steht ein ausführliches Erstgespräch mit den Eltern und eine standardisierte Diagnostik, um Schwierigkeiten, aber auch Ressourcen genau zu erkennen. Dabei werden u. a. folgende Bereiche geprüft:
- Lese- und Schreibfähigkeiten
- Phonologische Bewusstheit
- ggf. auditive Verarbeitungsfähigkeit (bei Verdacht auf eine zentrale Hörverarbeitungsstörung)
Falls notwendig, erfolgt eine weiterführende pädaudiologische Untersuchung beim HNO-Arzt.
Basierend auf den Ergebnissen wird ein individueller Therapieplan erstellt. Eltern und Lehrkräfte werden aktiv einbezogen, damit die Förderung auch im Alltag greift.
Was ist der Unterschied zwischen Lerntherapie, Nachhilfe und schulischer Förderung?
Was ist der Unterschied zwischen Lerntherapie, Nachhilfe und schulischer Förderung?
Die Begriffe werden oft miteinander verwechselt – dabei verfolgen sie unterschiedliche Ziele und Methoden. Hier ein Überblick:
Kriterium | Nachhilfe | Schulische Förderung | Lerntherapie |
Gruppengröße | Häufig größere Gruppen, aber auch einzeln | Meist kleinere Gruppen | In der Regel Einzelsetting oder maximal zu zweit |
Inhalte | Nachholen von aktuellem Schulstoff | Festigung von Grundlagen | Aufarbeitung größerer Lernrückstände |
Typische Gründe | Z. B. längere Fehlzeiten (Krankheit), Schulwechsel, Motivationsprobleme | Allgemeine Lernschwäche, Sprachdefizite, psychische oder körperliche Belastungen | Teilleistungsstörungen wie LRS oder Dyskalkulie, Schulfrust, Prüfungsangst, Lernblockaden |
Fachkräfte | Schüler:innen, Studierende, Lehrkräfte | Lehrkräfte, Förderpädagog:innen, Sonderpädagog:innen | Speziell ausgebildete Fachkräfte, Lerntherapeut:innen aus unterschiedlichen Berufsgruppen: Psycholog:innen, Pädagog:innen, Sprach- oder Ergotherapeut:innen |
Was ist das Besondere an der Lerntherapie?
In der Lerntherapie steht nicht nur der Lernstoff im Mittelpunkt, sondern das Kind als Ganzes. Ziel ist es, in einem geschützten Rahmen individuelle Lernwege zu finden – ohne Überforderung, dafür mit vielen kleinen Schritten, konkreten Erfolgen und gezielter Stärkung des Selbstvertrauens. Positive Lernerfahrungen und Freude am Lernen stehen im Fokus.
Was kostet eine Lerntherapie?
Lese-Rechtschreib-Störungen (LRS) sind offiziell als Erkrankung anerkannt – sie werden in der ICD-11-Klassifikation (ärztliches Diagnose System) unter den Nummern 6A03.0 (Lesestörung) und 6A03.1 (Rechtschreibstörung) geführt.
Trotzdem übernehmen gesetzliche Krankenkassen in Deutschland die Kosten für eine Lerntherapie nicht.
Die Verantwortung liegt bei den Schulen – doch oft fehlen dort die personellen oder finanziellen Ressourcen für eine ausreichende Förderung.
In bestimmten Fällen kann eine Lerntherapie über das Jugendamt finanziert werden – im Rahmen der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII. Voraussetzung ist, dass bei Ihrem Kind eine (drohende) seelische Behinderung vorliegt, z. B. durch die psychischen Belastungen, die mit der LRS einhergehen.
Die Bewilligung hängt vom Einzelfall ab und unterscheidet sich je nach Jugendamt. Dafür sind in der Regel folgende Schritte notwendig:
- Fachärztliches Gutachten (z. B. vom Kinder- und Jugendpsychiater)
- Pädagogisches Gutachten der Schule
- Antragstellung durch die Eltern beim zuständigen Jugendamt
Gerne unterstütze ich Sie bei diesem Prozess und berate Sie zu den notwendigen Unterlagen und nächsten Schritten.

